Vorbermerkung: Gerade zu Beginn des Textes mag euch einiges bekannt vorkommen. Ich lassen ihn trotzdem so. Es ist ein gewachsener Text, der entstanden ist, bevor ich überhaupt an diesen Blog dachte…

Depression
Seit zwei Jahren bin ich krank. Depressionen. F 33 irgendwas im ICD der WHO. Statistisch gesehen bin ich einer von 4 Millionen in Deutschland. Jeder fünfte Mensch hat Depressionen. Tendenz steigend. Entsprechend steigt die Zahl der Suizide. Mehr als 10 000 Menschen nehmen sich jährlich in Deutschland das Leben, mehr als durch Verkehrsunfälle, Aids, Mord und Drogen zusammen umkommen. Anders gerechnet: Alle 60 Minuten nimmt sich in Deutschland ein Mensch das Leben. Krass, oder? Die Dunkelziffer ist höher. Und klar: Nicht jeder Mensch, der sich das Leben nimmt, leidet unter Depressionen. Aber sehr, sehr viele. Die Depression ist eine fiese Krankheit, die tödlich enden kann. Der Suizid ist das äußerste, das letzte Symptom der Depression. Das ist bitter, denn Depressionen sind behandelbar, gut behandelbar. Sie sind vielleicht nicht vollständig heilbar. Mich z. B. werden sie wahrscheinlich immer ein Stück weit begleiten (andere vielleicht nicht), aber ich lerne mit meiner Depression zu leben, sie als Teil von mir zu sehen und sie auch mit Humor zu nehmen.
Wie wir mit Depressionen umgehen
Depressionen sind allgegenwärtig. Wir müssten dringend über sie sprechen. Und dennoch ist es so schwer über sie zu sprechen. Sie passen nicht in unsere Gesellschaft, in der sich so vieles um Selbstoptimierung dreht, in der wir Uhren tragen, die unsere Schritte im Flachen und unsere Schritte treppauf und treppab zählen, in der ein Bote mit einem Päckchen von Amazon unseren Hunger nach Sinn für einen winzigen Moment stillt, in der wir uns immer mehr über unseren beruflichen Erfolg und immer weniger über unser Sein definieren. Depressionen stehen gewissermaßen auf der anderen Seite dieser Gesellschaft, vielleicht sogar außerhalb dieser Gesellschaft. Sie passen nicht in das Bild. Sie werden stigmatisiert, sind mit Schuld, Scham und Versagen behaftet. In der Generation unserer Eltern, ich bin jetzt 41 Jahre alt, hatte man keine Depression und wenn doch, dann wurde sie in den meisten Fällen verschwiegen. Das ist kein Wunder: Unsere Eltern, geboren in den letzten Kriegsjahren oder in der Nachkriegszeit, waren mit dem Wiederaufbau beschäftigt, waren damit beschäftigt, das Wirtschaftswunder voranzutreiben, und verdrängten so das Trauma einer ganzen Generation. Depressionen und andere psychische Erkrankungen wurden zum Makel. Vieles hat sich seitdem geändert. Die Gesellschaft ist offener geworden, auch weil Berühmtheiten und Vorbilder wie Robbie Williams und J. K. Rowling offen mit ihren Depressionen umgehen. Aber auch aufgrund unserer wirtschaftlichen Lage und unseres Gesundheitssystems haben wir heute die Möglichkeit, unsere Traumata aufzuarbeiten und die Wunden, die aus anderen Generationen an uns weitergegeben wurden, zu heilen. Andererseits – Wer spricht schon über Depressionen. Und noch dazu über seine eigene?
Es bleibt unglaublich schwer, darüber zu sprechen. Depressionen haben meistens die anderen. Und selbst mit Blick auf andere fällt es schwer, die Krankheit beim Namen zu nennen. Jeder kennt jemanden, und sei es über Freunde, der den Belastungen nicht standgehalten hat und sich eine Auszeit nimmt, den der Beruf überfordert hat, oder, um weniger schöne Formulierungen zu nehmen: Jeder kennt jemanden, der völlig von der Rolle ist, der es nicht geschafft hat, der zu schwach ist, der in der Klapse oder in der Geschlossenen gelandet ist. Das macht den offenen Umgang nicht einfacher, auch wenn sich hinter Euphemismen und Abwertungen sicher Angst verbirgt. Die Angst, dass es einen selbst treffen könnte. Denn niemand ist vor der Depression gefeit. Sie kann jeden treffen: Politikerinnen, Professorinnen, Ärztinnen, Schauspielerinnen, Handwerkerinnen, Haushaltshilfen, Automechanikerinne, Lehrer*innen, Arbeitslose, Flüchtlinge, Wohlhabende, Arme. Jeden. Ausnahmslos. Jeden.
Diejenigen, die betroffen sind, verbergen häufig ihre Krankheit. Niemand lässt sich gerne schwach nennen, und es ist kaum zu ertragen, wenn einem als psychiatrieerfahrener Mensch Begriffe wie Klapse, Schizo oder Psycho um die Ohren fliegen. Also lieber nichts sagen. Besser den Mund halten, vor allem im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld. Dafür fragt man sich, warum es gerade einen selbst erwischt hat, sucht nach Gründen und Erklärungen. Gründe und Erklärungen machen es leichter, die Depression von Schuld, Scham und Versagen zu entlasten. Auch deshalb ist der Burnout die einzige Form der Depression, die gesellschaftlich am ehesten akzeptiert ist und über die offen gesprochen wird. „Immerhin habe ich mich fast zu Tode geschuftet und bin ausgebrannt, da kann ich auch guten Gewissens depressiv sein.“ So ungefähr. Nur keine Schwäche zeigen.

Auch ich habe tagelang und nächtelang nach Erklärungen und Antworten gesucht. Auch ich habe meine Depression zunächst Belastungsdepression und Erschöpfungsdepression genannt, um mir nicht das Etikett „Depression“ auf die Stirn kleben zu müssen. Aber wisst ihr was! Scheiß auf Etiketten. Ich habe eine Depression. Ich war schwer krank, ich war auf der Kippe und ich bin immer noch krank und lange noch nicht gesund. Es gibt für meine Krankheit tausend Gründe. Sicher genetische Vorbelastung, sicher bin ich über Jahre ans Limit gegangen, sicher bin ich über Jahre über mein Limit gegangen. Warum mein Limit irgendwann erreicht war? Warum ich überhaupt über mein Limit gegangen bin? Warum ich irgendwann krank wurde? Ob ich es irgendwie hätte verhindern können? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber auch hier sage ich: Scheiß auf die Gründe. Einen Menschen, der an Krebs erkrankt ist, frage ich in der Regel nicht: „Sag mal, warum hast du denn Krebs? Hast du zu viel gearbeitet, zu viel geraucht und getrunken? Ach übrigens, wo ich dich da mit deinem Becher Getreidekaffe sehe. Getreidekaffee, der soll ja auch krebserregend sein. Hab ich gehört. Ich weiß, den trinkst du gerne, aber vielleicht solltest du das jetzt besser lassen?“ Ich würde mir von mir wünschen, dass ich sage: „Verdammte Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Was kann ich tun? Gibt es etwas, das du von mir brauchst? Getreidekaffe? Okay. Besorge ich dir.“ Und so sage ich: Scheiß auf Beschönigungen, scheiß auf Erklärungen. Ich habe eine Depression, ich bin krank und ich muss lernen, damit umzugehen und damit zu leben. Aber selbst, wenn ich das so offen schreibe und mich damit befreie, fällt es mir schwer, über meine Depression zu sprechen und sie in Worte zu fassen. Sie kommt oft überfallartig in Situationen, in denen ich nicht damit rechne. Die Depression steht in meinem Wohnzimmer, obwohl ich sie gar nicht reingelassen, geschweige denn eingeladen habe. Ich habe sie mir bestimmt nicht gewünscht. Vor allem aber verstehe ich selbst nicht, was mit mir, was in mir passiert. Wie soll ich etwas erklären, was ich selbst nicht verstehe. Ich versuche es trotzdem, in dem ich euch schildere, was ich spüre.
Stellt euch vor…
Ihr liegt auf einer Wiese und seht eine Wolke an einem schönen Sommerhimmel und plötzlich wird die Wolke bedrohlich und spricht zu euch: „Alles wird enden.“
Ihr wacht eines Morgens auf und jegliche Kraft, jegliche Leistungsfähigkeit hat euch vollkommen verlassen.
Ihr wacht eines Morgens auf und schafft es nicht zur Arbeit gehen. Ihr wollt, aber ihr könnt nicht.
Ihr fahrt trotzdem los und dreht nach zehn Minuten weinend wieder um.
Ihr versucht es. Und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ihr be- verurteilt euch deshalb. Immer und immer wieder.
Ihr wollt mit euren Kindern spielen. Es geht nicht. Ihr wollt, aber ihr könnt nicht. Nach zwanzig Minuten liegt ihr erschöpft und zitternd im Bett.
Ihr be- und verurteilt euch deshalb. Immer und immer wieder.
Ihr könnt nicht für eure Kinder und Partner da sein. Ihr wollt, aber ihr könnt nicht.
Ihr be- und verurteilt euch…
Ihr zieht euch aus eurem Freundeskreis zurück, weil jedes Gespräch anstrengt.
Ihr könnt nicht fühlen. Keine Freude, kein Glück, keinen Schmerz, kein Leid. Nur grau.
Ihr könnt nicht weinen.
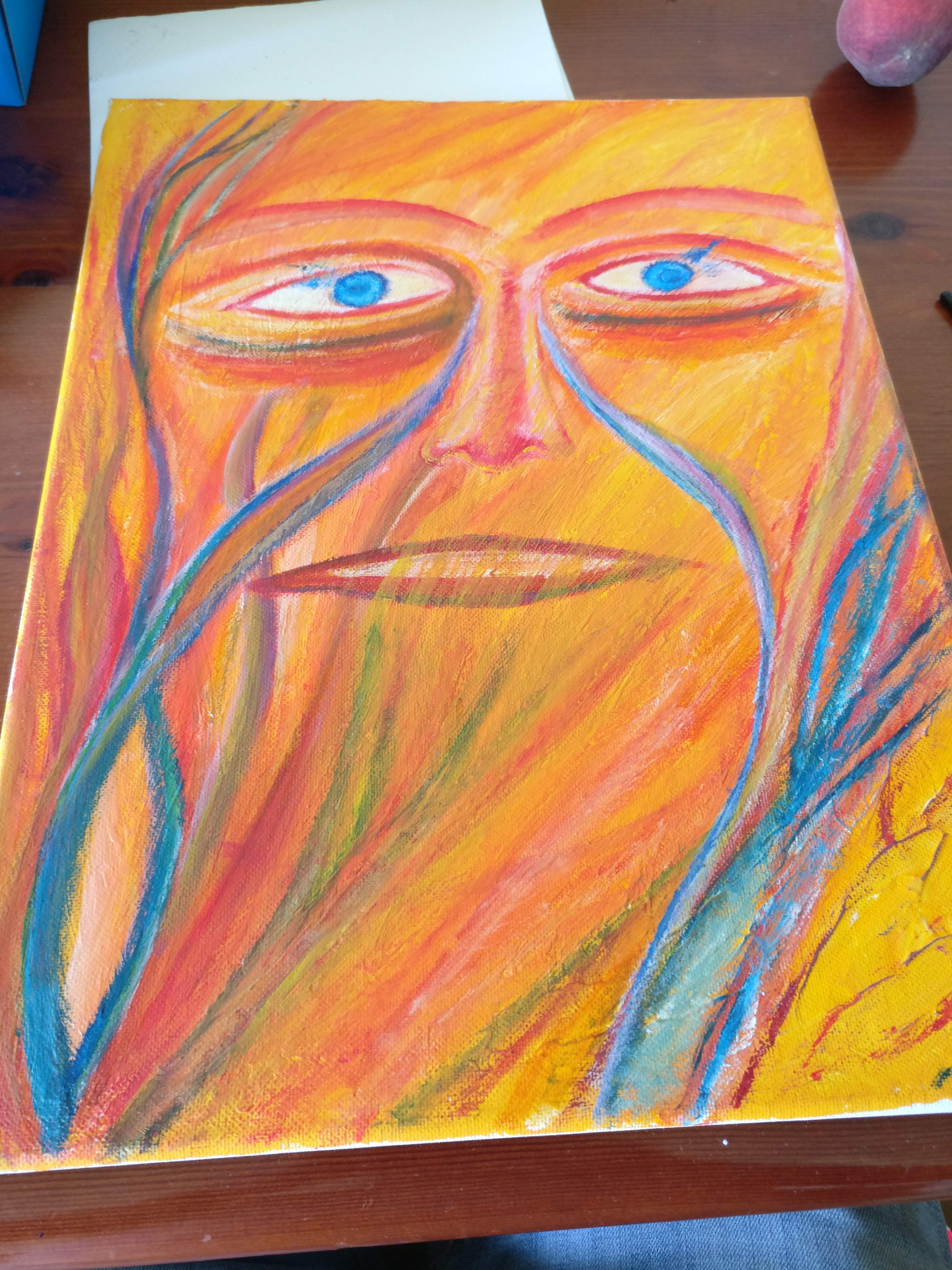
Ihr könnt nicht lachen.
Ihr könnt nicht reden. Ihr wollt, aber die Worte gehen euch nicht über die Lippen.
Ihr kommt in einen Raum mit Freunden und fühlt euch vollkommenen entfremdet. Selbst den besten Freunden.
Euer Geist entfremdet sich eurem Körper. Ihr fühlt euch vollkommen von euch selbst entfremdet. Euer Körper existiert getrennt von eurem Geist.
Euer Gehirn fühlt sich an wie ein Wattebausch oder ein feuchter Putzlappen, der zu lange in der Ecke gelegen hat. Oder auch wie beides.
Ihr wisst nicht mehr, was ihr am letzten Tag gemacht habt. Ihr könnt euch noch so sehr anstrengen. Ihr wisst es nicht mehr. Dabei habt ihr nur zwei kleine Bier getrunken.
Ihr seid dünnhäutig. So dünnhäutig, dass es unerträglich ist. Für alle.
Ihr seid ohne Filter unterwegs und nehmt ständig alles wahr.
Ihr seid in einem Café und ihr ertragt den Geräuschpegel nicht. Jedes Klirren eines
Kaffeelöffels erzeugt einen schmerzhaften Blitz in eurem Kopf, jedes Wort im Umkreis von 10 Metern hallt nach. Ihr müsst raus.
Ihr sitzt in der U-Bahn und spürt die Enge körperlich so sehr, dass euch übel wird.
Euch packt aus dem Nichts heraus eine unbegreifliche Angst, die sich langsam zur Panik steigert.
Ihr habt Angst. Vor allem. Vor Giftstoffen in Weintrauben. Dem Gift im Spielzeug eurer Kinder. Den komischen Abdrücken im Käse. Terroranschlägen, Handystrahlung, Viren, Herzinfarkten, Schlaganfällen, Lungenembolien und brasilianischen Pfeilgiftfröschen.
Eurem Selbst wird langsam mit einem sehr feinen Reibeisen die Haut heruntergeraspelt, bis alles wund und schrundig ist. Eure Haut brennt wie Feuer.
Euer Selbst und eure Seele, wie auch immer ihr es nennen wollt, stehen in Flammen. Und ihr könnt den Brand nicht löschen.
Ihr werdet langsam in einen schwarzen Abgrund gesogen, der euch euer Selbst aus dem Körper zu ziehen scheint.
Ihr wollt, dass es aufhört. Aber es hört nicht auf.
Ihr wollt, dass es besser wird. Ihr wollt leben. Aber es wird nicht besser.
Ihr wollt, dass endlich Ruhe ist. Dann kommt er, der Gedanke, der nicht sein darf, der mehr Angst macht als andere anderen. Was wäre, wenn wirklich Ruhe wäre? Wäre das nicht besser? Für alle. Dann kommt die Panik.
Ihr wollt, dass es besser wird. Ihr wollt leben. Aber es wird immer noch nicht besser.
Ihr wollt, dass es besser wird. Ihr wollt leben. Und dann wird es besser, ein ganz klein wenig nur, minimal, aber da ist winziger Streifen Licht.
So ungefähr fühlt es sich an. Für mich. Aber jeden Tag ist da ein Streifen Licht mehr.
Und? Angst? Unsicherheit? Falls dem so sein sollte, braucht ihr euch nicht zu schämen. Depressionen sind beängstigend. Und ich bin froh, dass in der Regel nicht alle Symptome auf einmal zuschlagen.
Was könnt ihr tun?
Vielleicht fragt ihr euch: „Was können wir, was kann ich tun, wenn es eine Freundin oder einen Freund trifft?“ Es gibt Dinge, die sind gut gemeint, aber helfen nicht. Und es gibt Dinge, die helfen. Erstmal zu den Dingen, die gut gemeint, aber wenig hilfreich sind.
Dinge, die (meistens) gut gemeint sind, aber nicht helfen…
„Okay. Da bin ich erleichtert. Nur eine Depression. Nichts Schlimmes. Puh.“ – „Das musst du jetzt mal rational betrachten.“ – „Ach du armer, das tut mir leid. Möchtest du noch einen Kaffee?“ – „Jeder ist mal ein bisschen traurig.“ – „Da musst du jetzt durch und dich zusammennehmen. Andere haben es auch schwer.“ – „Meinst du nicht, es ist jetzt genug mit der Depression?“ – „Ja, das mit der Müdigkeit kenne ich. Ruh dich mal zwei Wochen aus, dann geht das wieder.“ – „Mensch, Du bist schon wieder ganz der Alte! Oder?“ – „Wein doch mal. Weinen hilft immer.“ – „Trink mal ein Bier. Lass mal die Sau raus.“ – „Was machst du eigentlich, wenn die Krankenkasse kein Geld mehr zahlt?“ – „Sag mal, in deiner Familie hat sich doch jemand das Leben genommen. Es ist ja nachgewiesen, dass Suizid sich vererbt. Wie gehst du denn damit um? (wenig hilfreich, abgesehen davon, dass es Blödsinn ist).“
Nicht alles davon wurde mir gesagt, aber vieles. Und das Übrige anderen, die ich kenne. Habe ich jetzt abgerechnet und mich ausgekotzt? Ja. Vielleicht. Ein klein wenig. Aber ich denke, dass es wichtig ist, anderen bewusst zu machen, wie verletzend manche dieser Aussagen, Nachfragen und Ratschläge sind. Einer der häufigsten Ratschläge, der tatsächlich ein Schlag ist: „Reiß dich zusammen. Dann wird das wieder.“ Ebenso gut könnte ich jemandem mit einer offenen und blutenden Bauchwunde sagen: „Reiß dich zusammen. Dann wird das wieder.“ Ich will mich von meiner Kritik nicht ausnehmen. Auch mir fällt es schwer, manche Symptome zu verstehen. ‚Wie kann es sein,‘ habe ich mich während meiner Reha gefragt, ‚dass diese super-taffe Frau bis vor einem halben Jahr eine große Einrichtung für behinderte Menschen geleitet hat und urplötzlich morgens nicht mehr aufstehen konnte. Wenn sie sich das vornimmt, muss das doch gehen.‘ Ich hätte ihr gerne etwas Hilfreiches gesagt, aber mir fiel nichts, aber auch gar nichts ein. Außer: ‚Geh an die frische Luft, mach Sport, steh einfach auf.‘ Genau. Einfach. Der unschöne Höhepunkt meiner Ratschläge wäre gewesen: ‚Du musst es nur wollen.‘ Das war der Punkt, an dem ich mir dachte: ‚Halt einfach die Klappe. Es geht eben nicht. Es liegt nicht an ihr oder ihrem mangelnden Willen. Sie hat eine Depression. Genau wie du. Und sie kann morgens nicht aufstehen. Wie schwer muss es gerade für sie sein, das zu akzeptieren.‘ Ich bin seitdem wesentlich vorsichtiger mit meinen Urteilen geworden. Wer bin ich, dass ich die Messlatte meines begrenzten Verstandes an andere anlege und sie danach beurteile? Damals nahm ein junges Mädchen diese taffe Frau in den Arm und sagte zu ihr: „Ich kenne das. Es wird besser werden.“ Beide begannen zu weinen. Zuwendung und Empathie helfen ungemein. Also dazu.
Dinge, die helfen.
Seid da, wenn ihr es könnt. – Zeigt eure Gefühle und eure Hilflosigkeit. – Zeigt eure Angst. Depressionen sind beängstigend. – Sagt „Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll.“ – Sagt „Ich kann es nicht nachvollziehen, ich habe so etwas nie erlebt, aber ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Ich nehme es wahr und ich nehme es ernst. Ich nehme dich ernst.“ – Bietet eine Umarmung an und rechnet mit einem „Nein.“ Die Botschaft kommt trotzdem an. – Hört zu, fühlt mit und fragt, was der andere von euch brauchen könnte. – Seid ehrlich und sagt, wenn es euch zu viel wird und ihr eine Pause, auch eine längere Pause braucht. – Zieht Grenzen – Ladet euer Gegenüber immer wieder ein. – Unternehmt Spaziergänge, fahrt gemeinsam Fahrrad, schaut bescheuerte Filme. – Hört gemeinsam Musik. – Lest euch bescheuerte Horoskope vor. – Lacht, wenn euch danach ist, denn es steckt an. – Ermutigt eurer Gegenüber und stärkt ihm oder ihr bei jedem noch so kleinen Schritt den Rücken. – Seid euch bewusst, dass ihr wichtig seid für euer Gegenüber, dass ihr Leben seid, dass eure Freundschaft Leben bedeutet. – Seid stolz auf euch. Es hilft.

Zum guten Schluss.
Kommt jetzt auch noch der Lehrer in mir durch? Ja. Vielleicht. Ein klein wenig. Aber tatsächlich habe ich sehr viel von diesem Zuspruch erfahren in den letzten Jahren. Ich habe Verständnis von Menschen erfahren, von denen ich es nie erwartet hätte. Auch von meinem Arbeitgeber. Ich habe Offenheit, Zuneigung und Unterstützung von Freundinnen und Freunden erfahren. Ich habe erfahren, wieviel Liebe um mich herum ist. Sicher, manches Mal bin ich enttäuscht worden, aber der Zuspruch, das Verständnis, die Zuneigung und die Unterstützung überwiegen bei weitem und wachsen, je offener ich werde. Auch deshalb bin ich meinen besten Freundinnen und Freunden, meinen Kindern und vor allem Adina dankbar: Sie sind in den dunklen und in den hellen Stunden da.

Ob meine Depression jemals ganz vorbeigehen wird? Ich weiß es nicht. Vermutlich werden mich immer wieder depressive Episoden begleiten. Mich quält vor allem immer noch meine Erschöpfung, denn ich kannte keine Erschöpfung. Ich habe immer weiter gemacht, bis es kein weiter mehr gab. Auch heute noch habe ich Tage, an denen fällt mir einfach alles schwer. Jedes Aufstehen, jedes Gespräch ist mir zu viel. Mein Kopf dröhnt, ich bin so wahnsinnig dünnhäutig, jeder Geräuschpegel reibt an meinen Nerven. Aber diese Tage werden weniger. Genau wie die ganz dunklen Tage, an denen mich Verzweiflung und Abwertung bis hin zum Selbsthass packen.
Wie soll ich sagen, man gewöhnt sich auch an die dunklen Tage. Schön geht anders, aber jede depressive Episode, jeder dunkle Tag geht vorbei. Und mittlerweile, jetzt, da es mir langsam wieder besser geht, sehe ich, dass meine Depression mein Leben nicht nur beschwert, sondern auch vertieft hat. Ich bin mir meiner selbst bewusster geworden, ich achte mehr auf mich und sehe meine hohe Sensibilität nicht mehr als Makel, der mich in die Depression gestürzt hat, sondern als wertvolles Geschenk, das mir aus der Depression heraushilft. Meine Hochsensibilität hilft mir, mich selbst, andere und das Leben anders zu verstehen. Durch sie, die ich ohne die Depression vielleicht nicht kennengelernt hätte, habe ich einen anderen Blick auf das Leben gewonnen. Das ist doch ganz schön.

Ich kenne es. Ich hatte es und bekomme es immer wieder mal. Enge Freunde und Verwandte hatten es. Sogar meine Tochter hatte es. Freundinnen meiner Tochter haben und hatten es. Es ist sehr weit verbreitet.
LikeLike
Hallo Nils, ich habe die ARD Reportage über dich gesehen und ich finde es toll, wie offen du über deine Depression sprichst. Auch das Rad fahren dagegen finde ich toll: auch ich bin immer wieder von depressiven Episoden gequält, aber auch wenn ich dann nicht mehr arbeiten, zuhören, mich an Dinge erinnern kann und voller Angst bin: mein Fahrrad fährt immer noch mit mir. Auch wenn ich mich an meine Radtouren dann nicht mehr erinnern kann: es ist das einzige, was mich dann noch halbwegs erfreuen kann. Ich wünsche dir ganz viel Kraft.
LikeLike
Ich danke Dir für Deine offenen und treffenden Worte – erst gestern habe ich einen Namen gefunden für das was mich immer tiefer und tiefer in den Sumpf rammt, obwohl ich doch so dankbar sein müsste und obwohl es doch so viele Leute gibt, denen es viel schlechter geht…
Schwer ohne Scham zum Arzt zu gehen, wenn einem das Wasser unaufhaltsam aus den Augen springt. Schwer über Einweisung zu sprechen, über Möglichkeiten wie es weiter gehen soll – allein das Wort „weiter“ ist schon ein so bedrohliches.
Es ist schwer das Ruder loszulassen, an dem angeklammert man hilflos hängt – und doch meint: loslassen wäre noch schlimmer –
Heute zuckt ein wenig Kampfbereitschaft in mir auf. Und ich habe erkannt, dass ich dieses Quäntchen Kraft nutzen muss um Hilfe zu suchen, nicht wieder um mich noch ein wenig länger ans Ruder zu klammern.
Alles Gute Dir, Simonster
LikeLike